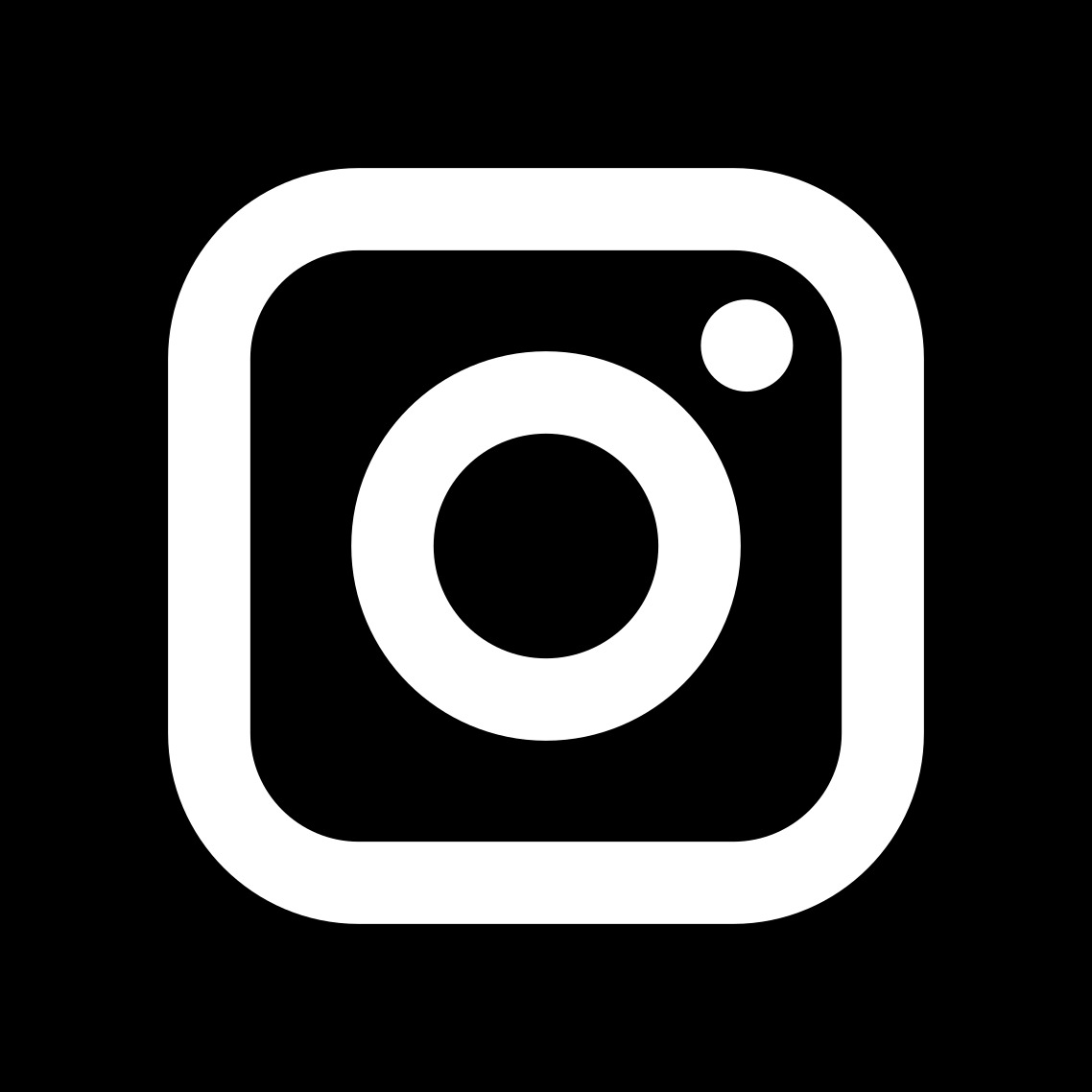VERANSTALTUNGEN IM HAUS SCHLESIEN
Februar 2026
Der erste Regierungschef der gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland wird bis heute hinsichtlich der Außenpolitik meist sofort mit dem Stichwort „Westintegration“ in Verbindung gebracht. Dies gewiss zu Recht, aber Adenauer hatte
Der erste Regierungschef der gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland wird bis heute hinsichtlich der Außenpolitik meist sofort mit dem Stichwort „Westintegration“ in Verbindung gebracht. Dies gewiss zu Recht, aber Adenauer hatte den Blick selbstverständlich auch nach Osten zu richten. Mit der DDR war zeitgleich ein zweiter deutscher Staat unter der Kontrolle der Sowjetunion entstanden, zudem war die Frage der Zukunft der früheren deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße mindestens aus der Sicht der Mehrheit der mehr als acht Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen offen, die unfreiwillig von dort nach Westdeutschland gelangt waren. Und zudem handelte es sich bei diesen zugleich um eine sehr große Bevölkerungsgruppe von hoher sozial- und innenpolitischer Relevanz.
Das Seminar nimmt Konrad Adenauers nach Osten gerichtetes (außen-)politisches Programm in den Blick und fragt nach dessen Stellenwert in der Gesamtpolitik des ersten Bundeskanzlers. Außerdem beleuchtet es die Vertriebenenpolitik in den beiden ersten Legislaturperioden 1949-1957.
Teilnahmegebühr: 145 € pro Person (1 Übernachtung mit Frühstück, 1 Abendmenu und 1 Mittagessen, Pausenversorgung mit Kaffee, Mineralwasser, Gebäck), ohne Übernachtung 90 € pro Person, für Mitglieder des Vereins HAUS SCHLESIEN 125 € bzw. 80 €.
Verbindliche Anmeldung bitte unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de
Mittwoch, 04.02.2026 13:30 - Donnerstag, 05.02.2026 15:00
11Feb19:00„Literarischer Reiseführer Niederschlesien“Buchvorstellung mit Autorin Roswitha Schieb
Dass Niederschlesien nicht nur ein Teppich arkadischer Gefilde, sondern auch eine reiche literarische Landschaft ist, legt Roswitha Schieb in fünf Partien durch das zehnfach interessante Land überzeugend dar: Im „Herzen
Dass Niederschlesien nicht nur ein Teppich arkadischer Gefilde, sondern auch eine reiche literarische Landschaft ist, legt Roswitha Schieb in fünf Partien durch das zehnfach interessante Land überzeugend dar: Im „Herzen Niederschlesiens“ reist sie am Zobten/Ślęża und um die Stadt Breslau/Wrocław herum auf der Suche nach den Ursprüngen der Region. In „Krieg und Frieden“ stellt sie Schauplätze religiöser und nationaler Kämpfe den Zeugnissen von Versöhnung und Verständigung gegenüber. „Schlesische Mystik“ spürt Schwarmgeister und Exzentriker von Görlitz über Bober-Katzbach- und Isergebirge bis Agnetendorf/Jagniątków auf. Riesengebirge, Hirschberger Tal und Rübezahl stehen im Kapitel „Bergromantik“ im Zentrum. Soziale Widersprüche und Einheit in Gottesgewissheit im Waldenburger und Glatzer Bergland führt das Kapitel „Getuppeltes, Gedoppeltes“ vor Augen. Unter den zahlreichen Stimmen von Literaten finden sich u.a. die von Gerhart Hauptmann und Olga Tokarczuk, die mit dem Nobelpreis gewürdigt wurden, sowie Andreas Gryphius, Daisy von Pless, Ruth Hoffmann, Arnold Zweig, Joanna Bator oder Filip Springer.
Eintritt frei, Anmeldung unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de erbeten.
Mittwoch, 11.02.2026 19:00
Die deutsche Vergangenheit ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der kollektiven Identität der polnischen Bevölkerung in Schlesien geworden. Heute bekennt man sich offen zum deutschen Erbe und setzt sich aktiv
Die deutsche Vergangenheit ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der kollektiven Identität der polnischen Bevölkerung in Schlesien geworden. Heute bekennt man sich offen zum deutschen Erbe und setzt sich aktiv für die Bewahrung und Pflege seiner materiellen Zeugnisse wie etwa Denkmäler oder historische Architektur ein. Doch dieser offene Umgang war nicht immer selbstverständlich. Im Rahmen einer kombinierten Führung und multimedialen Präsentation wird die Entwicklung im Umgang mit dem deutschen Kulturerbe eindrucksvoll nachgezeichnet und die damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen beleuchtet.
Entgelt 3,- Euro, Anmeldung unter kultur@hausschlesien.de oder 02244 886 231 erbeten.
Donnerstag, 19.02.2026 14:30
28Feb14:3018:00„Aber Flüchtling bleibt man doch...“Kompaktseminar
In den Jahren 1945 - 1947 kamen mehr als 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie ohne Hab und Gut in eine ihnen völlig fremde Umgebung.
In den Jahren 1945 – 1947 kamen mehr als 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie ohne Hab und Gut in eine ihnen völlig fremde Umgebung. Dort wurden sie häufig widerwillig aufgenommen: Nach dem Krieg herrschte Wohnungsnot, Hunger und Arbeitslosigkeit. In den einzelnen Besatzungszonen und später im geteilten Deutschland wurde in Politik und Gesellschaft unterschiedlich mit dem „Problem Nummer 1“ umgegangen. Erfahrungen der Eltern wie auch die eigenen aus dieser Zeit prägen bewusst und unbewusst bis heute viele Familien. Das Seminar vermittelt Grundlagenwissen und richtet sich vor allem an jene, die den Spuren dieser Erfahrungen in ihrer eigenen Biographie nachgehen wollen.
Teilnahmegebühr 30,- €, für Mitglieder des Vereins HAUS SCHLESIEN 25,- €, Anmeldung unter kultur@hausschlesien.de oder 02244 886 231 erforderlich.
Samstag, 28.02.2026 14:30 - Samstag, 28.02.2026 18:00
März 2026
Die Ausstellung beschreibt Flucht, Vertreibung und Integration aus weiblicher Sicht. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen individuelle Geschichten und Schicksale von sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen
Die Ausstellung beschreibt Flucht, Vertreibung und Integration aus weiblicher Sicht. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen individuelle Geschichten und Schicksale von sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europa stammen: Aus Ostpreußen, Pommern, Oberschlesien, Mähren und der Batschka. In der Ausstellung werden ihre Biografien zugleich in den großen Kontext der deutschen und europäischen Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 gestellt. Die aktuelle Schau öffnet den Blick für Erfahrungen und Herausforderungen, mit denen sich Frauen während der Flucht, Vertreibung und Integration nach dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert sahen. Spitzenpolitikerinnen westdeutscher Parteien und Ausnahmefrauen der Kulturszene kommen in der Ausstellung ebenso vor wie ihre „unsichtbaren“ Zeitgenossinnen, die den Alltag in den Familien oder den Kulturalltag in den Vertriebenenvereinen meisterten. Eine Ausstellung aus dem Haus des Deutschen Ostens München.
Eintritt frei, Anmeldung unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de erbeten.
Sonntag, 08.03.2026 15:00
19März14:30Schlesische Dreiviertelstunde „Das Plebiszit in Oberschlesien“Öffentliche Führung
Am 20. März 1921 stimmten die Oberschlesier darüber ab, ob sie zu Deutschland oder Polen gehören wollten. Im Vorfeld warben beide Länder durch eine Propagandakampagne um die Gunst der Bevölkerung,
Am 20. März 1921 stimmten die Oberschlesier darüber ab, ob sie zu Deutschland oder Polen gehören wollten. Im Vorfeld warben beide Länder durch eine Propagandakampagne um die Gunst der Bevölkerung, was zu einer Nationalisierung und Polarisierung führte, die sich sogar durch die Familien zog. Es kam zu Zusammenstößen im Vorfeld der Wahl und letztlich faktisch zu einem Bürgerkrieg. Die Führung beschäftigt sich mit der Frage nach der nationalen Zugehörigkeit der Oberschlesier.
Entgelt 3,- Euro, Anmeldung unter kultur@hausschlesien.de oder 02244 886 231 erbeten.
Donnerstag, 19.03.2026 14:30
April 2026
18April10:0018:00Frauenschicksale zwischen Weimarer Republik und WiederaufbauTagung
Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg trugen Frauen enorme Verantwortung: Sie sorgten für Familie und Lebensunterhalt, führten Betriebe weiter, leisteten Widerstand, versteckten Verfolgte oder waren selbst von Zwangsarbeit, Flucht
Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg trugen Frauen enorme Verantwortung: Sie sorgten für Familie und Lebensunterhalt, führten Betriebe weiter, leisteten Widerstand, versteckten Verfolgte oder waren selbst von Zwangsarbeit, Flucht und Vertreibung betroffen. Die Tagung beleuchtet anhand von Biografien bekannter Frauen wie Gussie Adenauer und Freya von Moltke sowie vieler unbekannter Alltagsheldinnen aus Königswinter die Jahre von den 1930er bis in die 1950er. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Familiengeschichten zu reflektieren. Eine Tagung von
HAUS SCHLESIEN in Zusammenarbeit mit der VHS Siebengebirge, dem Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter und der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus.
Anmeldung unter Tel. 02244/886 231 oder kultur@hausschlesien.de. Die Zahl der Plätze ist begrenzt!
Tagungspauschale 70 € (inkl. Drei-Gang-Menü und zwei Kaffeepausen).
Samstag, 18.04.2026 10:00 - Samstag, 18.04.2026 18:00